Dieses Mal geht es um das Tetralemma. Ursprünglich aus der indischen Logik stammend, wurde es von Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer für die systemische Arbeit adaptiert und weiterentwickelt. Das Tetralemma bietet eine strukturierte Methode, um komplexe Entscheidungssituationen, festgefahrene Denkmuster und innere Konflikte zu analysieren und neue Möglichkeiten zu entwickeln. Statt sich zwischen zwei Alternativen entscheiden zu müssen, werden neue Optionen und Perspektivwechsel ermöglicht, die oft zu kreativen und unerwarteten Lösungen führen.
Es kann bei allen Arten von inneren Konflikten genutzt werden, wie Entscheidungs-, Ziel- oder Wertekonflikten bis hin zur Arbeit mit Glaubenssätzen. Auch für die Lösung von Konflikten zwischen Personen oder Geschäftsbereichen ist das Tetralemma ein hervorragender Ansatz. Und für vieles mehr.
Die philosophischen Ursprünge des Tetralemmas
„Das Tetralemma ist eine Struktur aus der traditionellen indischen Logik zur Kategorisierung von Haltungen und Standpunkten. Es wurde im Rechtswesen verwendet zur Kategorisierung der möglichen Standpunkte, die ein Richter in einem Streitfall zwischen zwei Parteien einnehmen kann. Er kann der einen Partei recht geben oder der anderen Partei oder beiden (jede hat recht) oder keiner von beiden. Diese vier Positionen wurden (…) um die Negation des erweitert.
Das Tetralemma ist ein außerordentlich kraftvolles allgemeines Schema zur Überwindung jeder Erstarrung im schematischen Denken. Es stellt also eine Synthese von schematischem Denken und Querdenken auf höherer Ebene dar.“ – Varga v. Kibéd, „Ganz im Gegenteil“, 2003, S.77
Das Tetralemma basiert auf einer Theorie der indischen Logik und Philosophie. Der Begriff stammt aus der buddhistischen Tradition der Madhyamaka-Philosophie des Mittleren Weges und wurde erstmals von Nagarjuna beschrieben, der im 2. Jahrhundert lebte. Bereits in den Texten über Buddha lässt sich diese Idee, wenn auch weniger explizit, wiederfinden. Die Theorie des Tetralemmas besagt, dass man zu zwei gegenteiligen Thesen, Überzeugungen, Standpunkten vier mögliche Positionen einnehmen kann: A ist wahr und B ist falsch, A ist falsch und B ist wahr, beide sind wahr, keines von beiden ist wahr. Diese Grundstruktur fand auch in der Rhetorik und im indischen Gerichtswesen Anwendung:
- These: Nur A ist wahr, bzw. A hat recht.
- Antithese: Das genaue Gegenteil der Position 1. Also: Nur B ist wahr, bzw. B hat recht.
- Synthese: Beide Aussagen oder Standpunkte sind wahr. A und B sind wahr, bzw. A und B haben recht.
- Weder noch: Keine der Aussagen oder Standpunkte sind wahr. Also: A und B sind nicht wahr, bzw. A und B haben unrecht. (Etwas anderes ist wahr oder übergeordnet.)
Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer erweiterten dieses Modell explizit um eine, der buddhistischen Lehre bereits innewohnende, fünfte Position:
- All dies nicht – und selbst das nicht.
Diese Erweiterung ermöglicht es, über die scheinbar vollständige Logik der ersten vier Positionen hinauszugehen und völlig neue Perspektiven zu entwickeln.
Die 5 Positionen des Tetralemmas nach Kibéd und Sparrer
- Das Eine – Die Fixierung. Die bisher bevorzugte, aber nicht wirklich zufriedenstellende Lösung.
- Das Andere – Das Dilemma. Das Andere steht zum Einen im Gegensatz.
- Beides – Die übersehene Verbindung (internes Reframing). Dieses neue Element ist eine Metaposition zu dem Dilemma, in der man sich vom „entweder-oder“ dem „sowohl-als auch“ zuwendet. Damit verlässt man den Raum des Dilemmas und begibt sich in einen neuen übergeordneten Rahmen, der neue Sichtweisen eröffnet.
Es gibt viele verschiedene einander überlappende „Beidesformen“, hier einige Beispiele:
- Kompromiss: Von jedem ein bisschen
- Kontextualisierung: Räumliche Trennung oder Trennung nach Bereichen
- Iteration, Oszillation (sequentielle Lösung): Mal/erst das Eine, mal/dann das Andere
- Scheingegensatz: Das Dilemma ist gar keins, da die Alternative keine wirkliche ist. („Mache ich es jetzt oder später?“ Ich mache es aber auf jeden Fall).
- Paradoxe Verbindung: Reframing – das Eine ist eigentlich auch das Andere.
- Ressourcentransfer: „Die Kraft des Nichtgewählten in das Gewählte einfließen lassen“
- Dimensionserweiterung: Gegenseitige Ergänzung
- Keins von Beiden – Der übersehene Kontext (externes Reframing). In dieser Position sind wir nicht mehr mit einer der Optionen verwickelt. Es geht nicht mehr um Vereinbarkeit, sondern um den Kontext, in dem der Gegensatz entstanden oder nützlich ist. Damit verlieren die ursprüngliche Fragestellung und somit auch die Positionen 1 und 2 ihre strikte Geltung. Das gibt dem Ganzen eine neue Dimension und Sinn. „Wofür ist das Dilemma gut?“ „Was willst du gerade nicht sehen?“ „Was würde passieren, wenn du das Dilemma lösen würdest?“
- All dies nicht – und selbst das Nicht – Die reflexive Musterunterbrechung. Wer glaubt, diese „fünfte Position“ der verneinenden Selbstverneinung (Nichtposition) verstanden zu haben, zeigt eben dadurch, dass er sie nicht verstanden hat.
Ein paar Anmerkungen
Während die Position „Beides“ auf die übersehene Vereinbarkeit der beiden Pole hinweist, zielt die Position „Keines von Beidem“ auf übersehene Kontexte, Themen und Möglichkeiten. Die fünfte (Nicht)position stellt eine wesentliche Musterunterbrechung dar.
Die fünfte Position „All dies nicht – und selbst das Nicht!“ ist die Negation des 4-poligen Tetralemmas. Diese Position ist geteilt und wird auch so ausgesprochen: „All dies nicht (Sprechpause) und selbst das nicht!“. Sie besteht aus einer zunächst „schwachen“ Fünf (All dies nicht), die Skepsis ausdrückt und durch den zweiten Teil zu einer „starken“ Fünf (und selbst das Nicht!) wird, die Offenheit in alle Richtungen signalisiert. Diese verneinende Selbstverneinung ist nicht zu verstehen und wird eben dadurch zu einer staken Ressource im System. Damit kann gleichzeitig etwas Neues, das den Interessenausgleich vorbereitet und Lösungen andeutet, entstehen – oder es erzeugt erneut das „Eine“ und das „Andere“. Die Entwicklung kann dann auf einer anderen, höheren Ebene weitergehen – bis der Konflikt sich auflöst und eine Lösung sichtbar wird.
Keine der vier Positionen und nicht einmal die fünfte Nicht-Position ist „besser“ als eine andere Position. Die fünfte hat allerdings den Vorzug, weniger rigide zu sein. Bei der Tetralemmaaufstellung geht es darum, den nächsten Schritt in einem Entwicklungsprozess zu finden. Die fünfte Nicht-Position kann manchmal auch zu einer neuen ersten Position im Tetralemma werden.
Durchführung des Tetralemmas
Das Tetralemma basiert auf der Annahme, dass Menschen in Entscheidungssituationen häufig in dualistischen Entweder-Oder-Mustern denken. Diese Einschränkung führt oft zu unbefriedigenden Lösungen oder Blockaden. Das Tetralemma hilft dabei, diese eingeschränkte Sichtweise zu überwinden und neue Handlungsoptionen zu erschließen.
Ausgangspunkt des Tetralemmas ist ein Dilemma oder ein Konflikt. So kannst du vorgehen:
- Konkrete Definition des Dilemmas
Was genau ist Option A und was ist Option B?
- Definieren der 5 Positionen
Um das Tetralemma intensiver zu erleben und in die fünf Positionen besser reinfühlen zu können, arbeite mit Bodenankern, Figuren, Zetteln…. Der Klient kann sich dann an die Positionen stellen oder mit der Hand dorthin fühlen. Die Positionen können prototypisch ausgelegt werden (siehe Bild unten) oder der Klient wählt sie selbst. Am besten verortet man jede Position, wenn sie erforscht wird.

- Erforschung der 5 Grundpositionen des Tetralemmas
Der Klient erforscht nacheinander die 5 Positionen, lasse in jeder Position einige Minuten Zeit. Insbesondere die fünfte Position erzeugt zu Beginn oft eine Art geistige Leere und es dauert eine Weile, bis ein Gefühl oder Gedanke auftaucht.
- Integration
Im letzten Schritt werden die Erkenntnisse aus den verschiedenen Positionen zusammengeführt. Der Klient wird ermutigt, neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und konkrete Schritte zu planen, um seine Ziele zu erreichen. Hier geht es um das Sammeln der gewonnenen Einsichten, das Entwickeln konkreter Handlungsoptionen und erster Schritte und das Ausarbeiten des Transfers in den Alltag.
Tipps und Hinweise
Zeitmanagement
Plane genügend Zeit für die Durchführung des Tetralemmas ein. Je nach Komplexität wird die Bearbeitung des Themas in der Regel zwischen 30 und 90 Minuten dauern.
Präzise Themenstellung
Wenn das Thema zu vage ist, kann das Tetralemma oft nicht effektiv eingesetzt werden. Wähle daher besser ein konkretes Thema und einen konkreten Kontext.
Positiv formulierte Positionen A und B
Wenn die Gegenposition (B) nur die Abwesenheit der Position (A) ist, kann das Tetralemma ebenfalls oft nicht effektiv eingesetzt werden. Beispiel: Angestellt vs. selbständig arbeiten. Statt: Angestellt vs. nicht angestellt arbeiten.
Modalitäten der Durchführung
Das Tetralemma kannst du auf vielerlei Weise durchführen:
- in der Vorstellung
- mit Zetteln oder Figuren, die berührt werden
- mit Bodenankern, Positionen im Raum, die eingenommen werden, z.B. gekennzeichnet mit Zetteln oder Stühlen
- Tetralemma als Aufstellung mit 5 Personen (plus Klient)
Vertiefende Fragen für jede Position
- Was nimmst du hier wahr?
- Welche Gefühle sind präsent?
- Welche (neuen) Möglichkeiten zeigen sich?
- Was verändert sich in deiner Wahrnehmung, in deinem Fühlen, in deinen Gedanken zu dem Thema?
Über das Denken hinaus
Richte den Fokus auch auf körperliche und emotionale Wahrnehmungen. Den Prozess nur zu denken, führt oft zu schwächeren Ergebnissen.
Dokumentation
Da in dem Prozess sehr viele Informationen auftauchen werden, ist es nützlich, die zentralen Erkenntnisse zu notieren.
Variationen und Erweiterungen des Tetralemmas
Das Tetralemma lässt sich durch verschiedene Variationen und Erweiterungen an spezifische Coaching-Anliegen anpassen. Hier ein paar Beispiele:
Erweiterung: Transformation der ersten 4 Positionen des Tetralemmas durch die 5te
Nachdem alle 5 Positionen erforscht und erlebt wurden, nutze die kraftvolle Energie der 5ten Position, um damit die Positionen 1-4 zu transformieren. Arbeite z.B. mit Sätzen wie: „Und nun nimm all dies (Position 5) in das hier (nacheinander Position 1-4) mit hinein. Und nimm jetzt wahr, was sich verändert.“. Gib jeweils etwas Zeit, die Transformation zu spüren und frage dann: „Was ist jetzt?“
Tetralemma der Werte
Hier werden zunächst die ersten 2 Positionen mit unterschiedlichen Werten besetzt, um Wertkonflikte zu analysieren. Die anderen 3 Positionen ergeben wiederum Werte.
Tetralemma mit einer Annahme oder Überzeugung (Rhetorik)
A: These: Ausgangspunkt ist eine einschränkende Annahme oder Überzeugung.
B: Antithese: „Was ist dann nicht wahr?“
C: Synthese: „Könnte beides wahr sein?“ „Wann wäre auch das andere wahr?“
D: Kontext: „Wann oder in welchem Fall könnte weder A noch B wahr sein?“ / „Geht es eigentlich gar nicht um A oder B? Sondern um etwas ganz anderes?“ / „Was braucht nicht angesehen werden, solange es darum geht, ob A oder B wahr ist?“
E: All dies nicht – und selbst das nicht: „Was ist wichtiger oder bedeutsamer als recht zu haben?“
Erweiterung Tetralemma der Ressourcen
Hier werden die Ressourcen erforscht, die dem Klienten in den verschiedenen Positionen zur Verfügung stehen.
Anwendung in Teams
Das Tetralemma kann auch hervorragend in Teamprozessen eingesetzt werden, um Entscheidungsfindungen oder Konflikte zu klären.
Fazit
Das Tetralemma ist ein großartiges Format, um Klärung oder Lösung für innere oder äußere Konflikte zu finden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind umfangreich, du kannst es hervorragend für dich selbst nutzen, im Coaching mit Einzelpersonen, im Teamcoaching, in der Konfliktmediation und in der Unternehmensberatung. Wir unterrichten das Tetralemma neben vielen anderen Formaten in unserer NLP-Master-Ausbildung, vielleicht hast du ja Lust, es dort kennenzulernen.


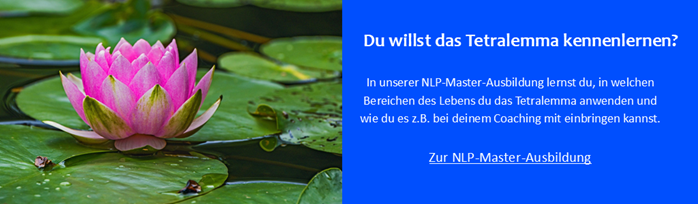

0 Kommentare